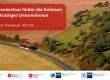Wie beeinflusst Künstliche Intelligenz unser Kommunikationsverhalten – und was macht sie sympathisch?
Diese Fragen standen im Mittelpunkt der diesjährigen DigiCom & Human-Machine-Communication-Konferenz am Institut für Kommunikationswissenschaft der TU Dresden. Über 50 Forschende und Praktiker:innen aus internationalen Hochschulen und Innovationszentren diskutierten hier vom 15. bis 17. September 2025 aktuelle Forschungsergebnisse und Praxisbeispiele rund um virtuelle Influencer, Chatbots und KI-Avatare.
Mit dabei war auch Dr. Ninette Florschütz, Leiterin der Modellfabrik Vernetzung am Mittelstand-Digital Zentrum Ilmenau, um Impulse für den Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Unternehmenskommunikation mitzunehmen und sich mit internationalen Kolleg:innen aus der DGPuK (Deutsche Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft) und der ICA (International Communication Association) zu vernetzen.
Vernetzung und Austausch zu aktuellen Forschungstrends
Die Tagung bot eine wertvolle Gelegenheit, wissenschaftliche Erkenntnisse mit der praktischen Arbeit in den Modellfabriken zu verknüpfen. Im Fokus stand die Frage, wie Menschen KI-gestützte Systeme im Alltag erleben und wie sich emotionale Beziehungen zu digitalen Assistenten, Avataren oder Influencern entwickeln. Diese Perspektive ist besonders relevant für kleine und mittlere Unternehmen, die zunehmend überlegen, wie sie KI kreativ und verantwortungsvoll in ihre Kommunikation integrieren können.
Virtuelle Influencer: Zwischen Authentizität und Akzeptanz
Ein zentrales Thema des ersten Konferenztages war die Akzeptanz von Künstlicher Intelligenz im beruflichen und medialen Alltag. Besonders interessant: Forschende der University of Central Florida präsentierten Ergebnisse, nach denen Kund:innen virtuelle Influencer zunächst sympathischer empfinden, wenn sie diese für echte Menschen halten. Wird später offengelegt, dass es sich um eine KI handelt, sinkt die Sympathie – außer die Enthüllung wird als positiv erlebt. In diesem Fall kann die Bindung sogar stärker werden und Werbung wirkt effektiver.
Gerade für inhabergeführte Unternehmen, deren Inhaber:innen ungern selbst vor die Kamera treten, eröffnet KI neue Chancen in der Markenkommunikation. Entscheidend ist dabei eine kluge Inszenierung. Erfolgsfaktoren sind hierbei:
- Transparenz: Von Anfang an klarstellen, dass es sich um eine virtuelle Figur handelt
- Storytelling: Herkunft, Mission und Werte spannend erzählen
- Humor: Selbstironischer Umgang mit der KI
- Mehrwert-Kommunikation: Ständige Verfügbarkeit, kreative Szenarien, keine Skandale
- Markenwerte verknüpfen: z. B. Qualität, Nachhaltigkeit
- Dialog fördern: Follower aktiv einbeziehen, etwa durch Abstimmungen oder Feedbackrunden
So kann Künstlichkeit nicht als Täuschung, sondern als Mehrwert erlebt werden – vergleichbar mit animierten Maskottchen, die Sympathie und Vertrauen schaffen.
Avatare und Chatbots: Wenn Kommunikationsstil wichtiger ist als Aussehen
Am zweiten Tag stand das Thema parasoziale Interaktion mit KI-Agenten im Fokus. Diskutiert wurde, wie sich das Verhalten von NutzerInnen verändert, wenn diese regelmäßig mit Chatbots oder virtuellen Avataren interagieren. Besonders interessant: Der bekannte „Proteus-Effekt“ – also die Tendenz, Eigenschaften eines Avatars zu übernehmen – ließ sich dabei nicht direkt auf KI-Assistenten übertragen. Statt des Aussehens prägen vielmehr Kommunikationsstil und Persönlichkeit der KI den Umgang der Nutzenden mit der Technik.
Studien zeigen, dass emotionale Bindungen zu Chatbots durch kontinuierliche, wertschätzende Kommunikation und ständige Erreichbarkeit entstehen. Die Menschen übernehmen hierbei häufig den Tonfall und das Stimmungsbild ihrer digitalen Gegenüber – teils unbewusst. Besonders spannend: Wer mit einem widersprechenden Chatbot interagiert, zeigt anschließend eine höhere Bereitschaft, sich auf Gespräche mit andersdenkenden Personen einzulassen. Dieses Phänomen wird als individuelle Entpolarisierung bezeichnet und kann helfen, Toleranz und Debattierfähigkeit in der Gesellschaft zu fördern.
Zugleich wirft die Forschung neue Fragen auf: Führt die Interaktion mit KI zu sozialer Entkopplung – oder entsteht daraus neue Empathie und Offenheit? Und, zugespitzt formuliert: Wer trainiert hier eigentlich wen – der Mensch die Maschine oder umgekehrt?
Fazit
Die DigiCom & Human-Machine-Communication-Konferenz hat gezeigt, dass die Zukunft der Kommunikation nicht in der Konkurrenz, sondern in der Kooperation zwischen Mensch und Maschine liegt. Für die Arbeit der Modellfabrik Vernetzung am Mittelstand-Digital Zentrum Ilmenau bedeutet das: Den Mittelstand dabei zu unterstützen, KI-Technologien transparent, empathisch und werteorientiert einzusetzen – damit ihr Einsatz Vertrauen erhält, Dialog fördert und neue Formen der Zusammenarbeit ermöglicht.
Bildquellen
- TU Dresden – DigiKomm: © Mittelstand-Digital Zentrum Ilmenau